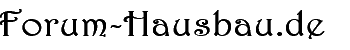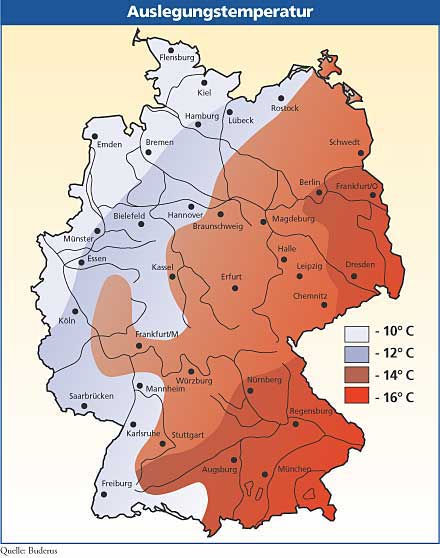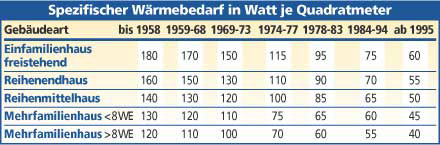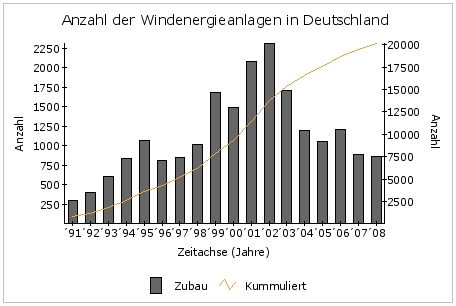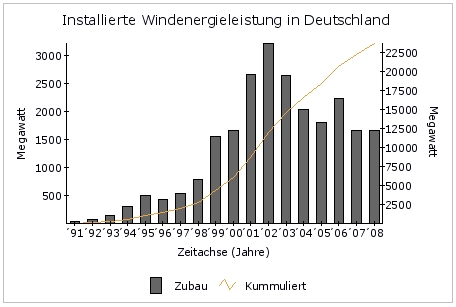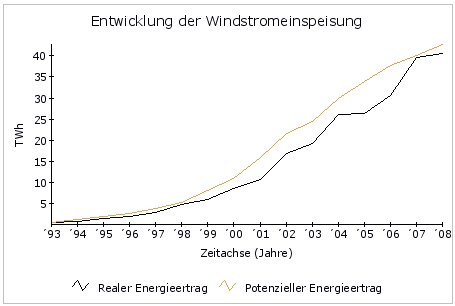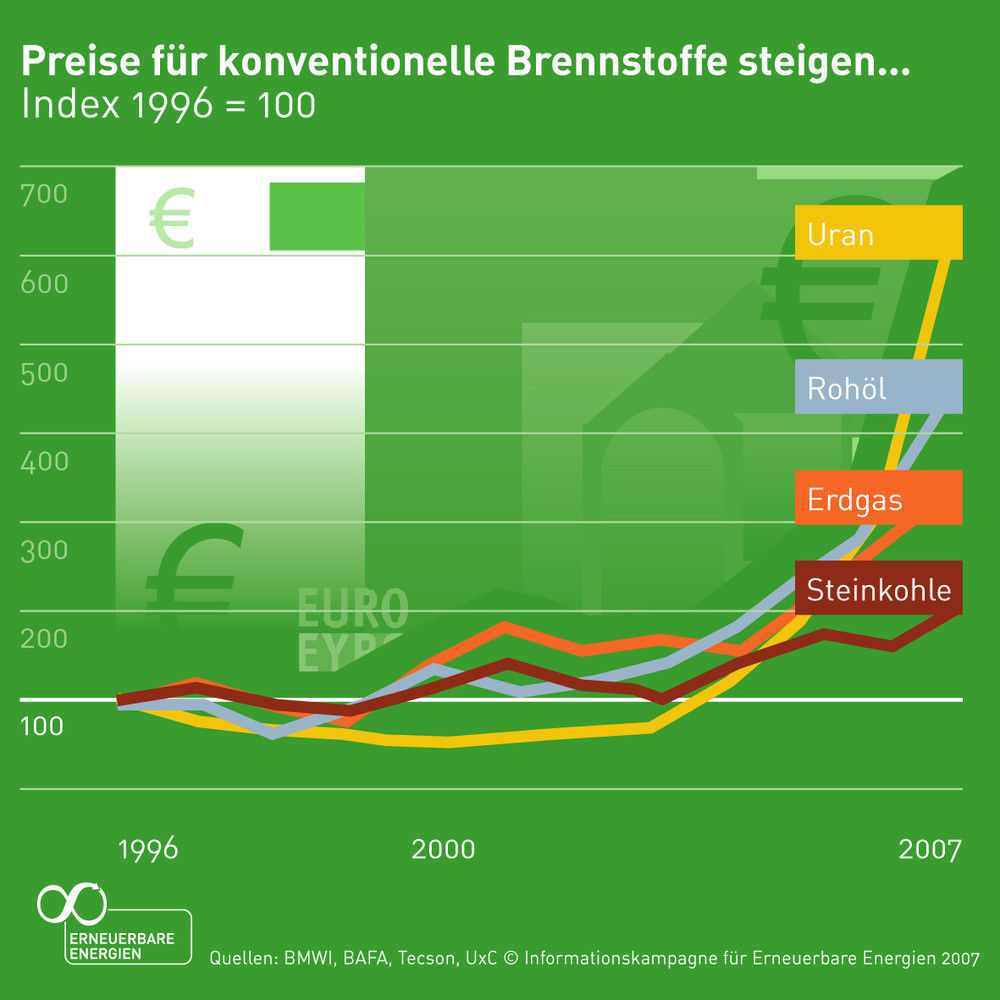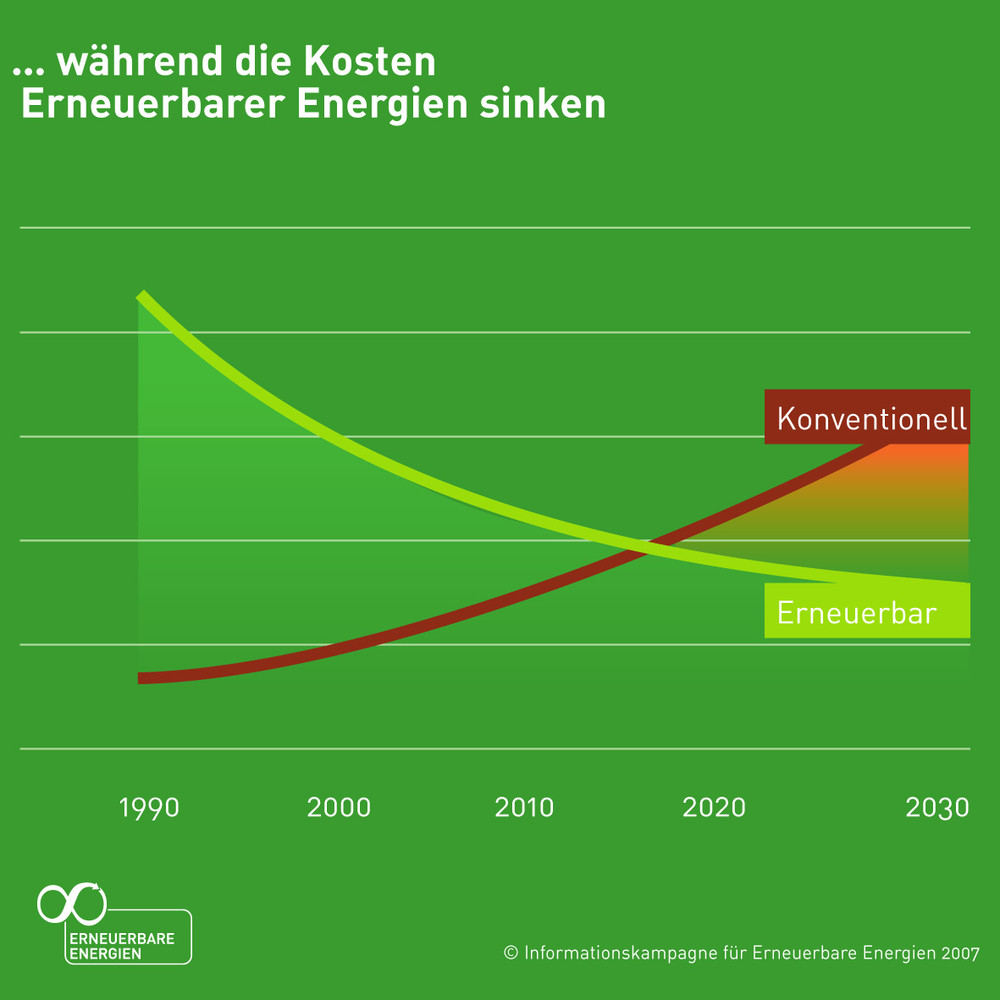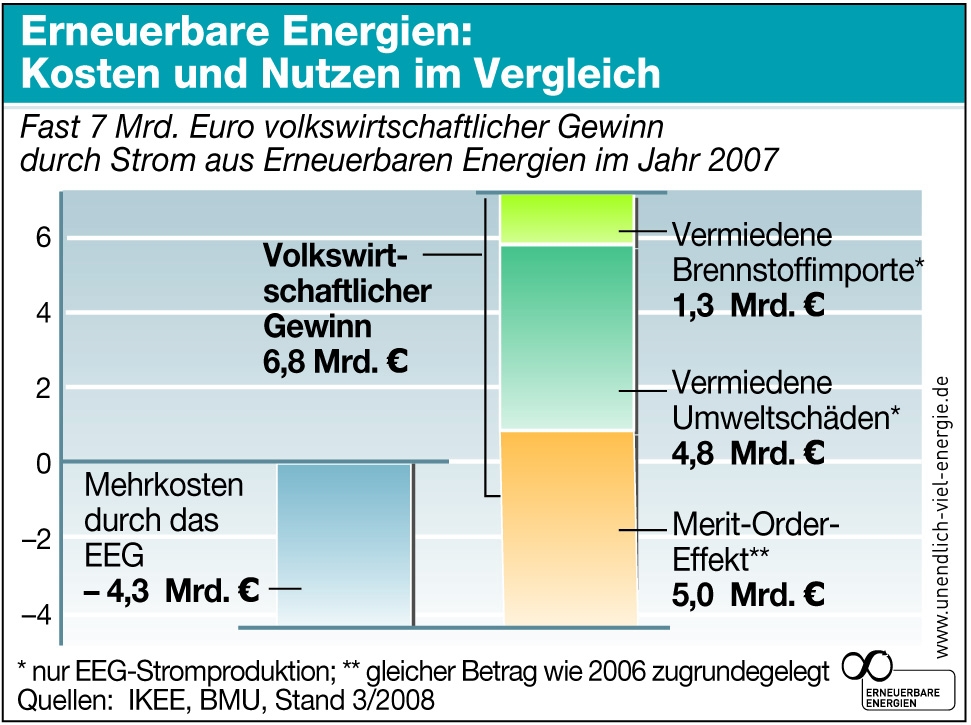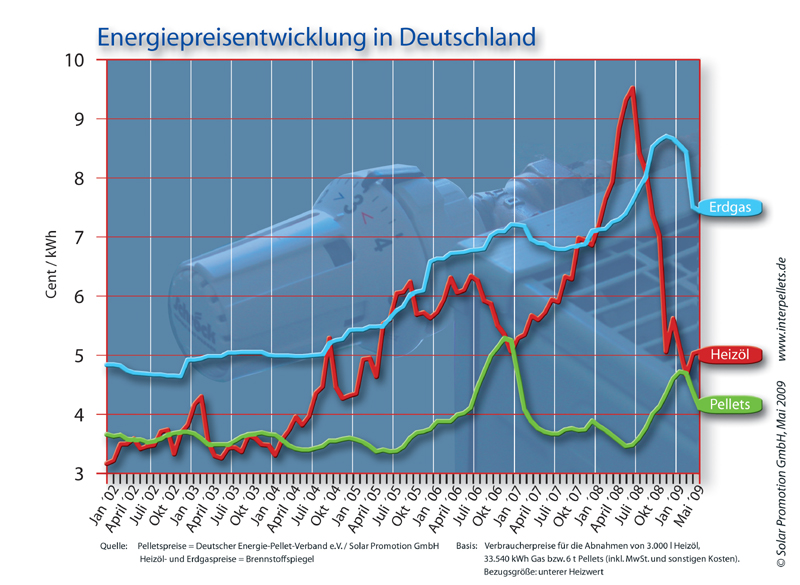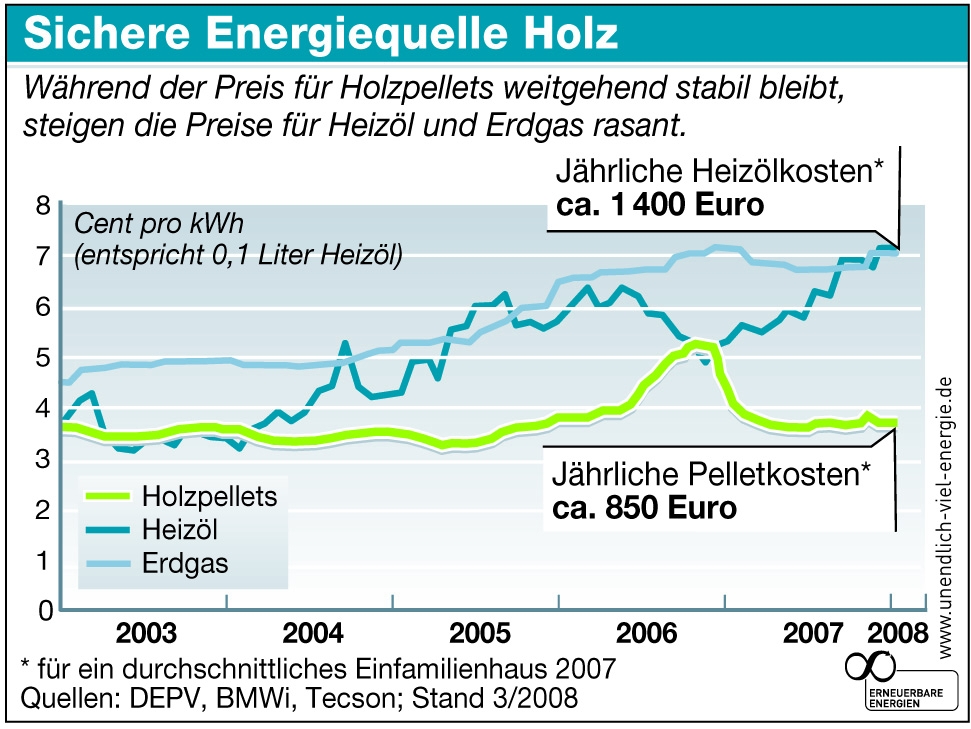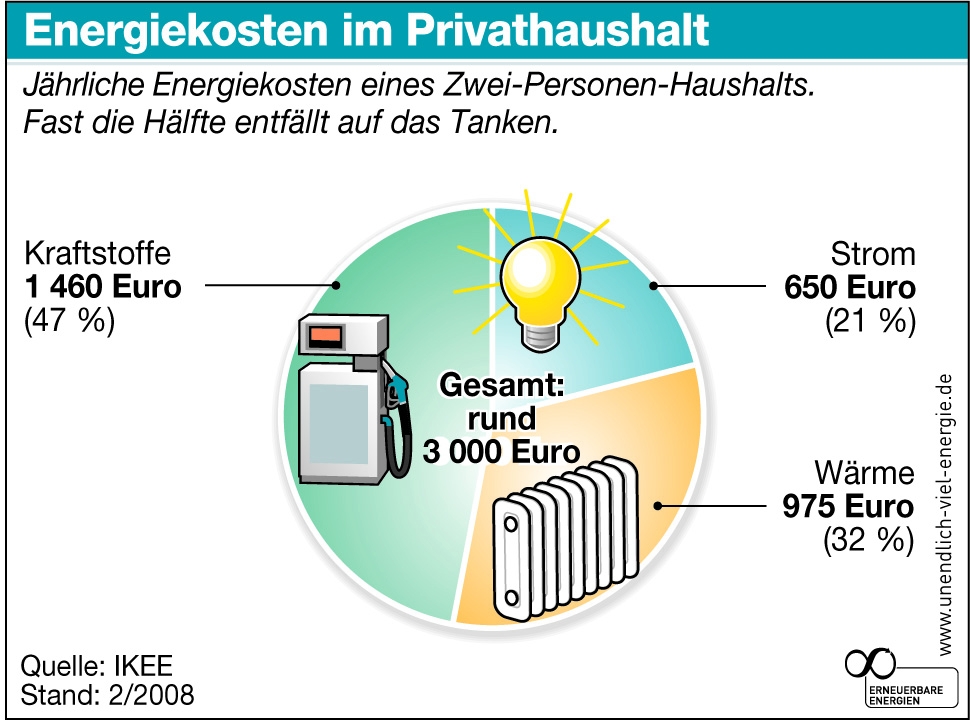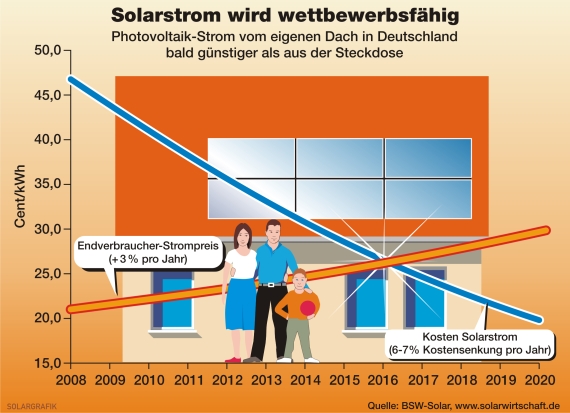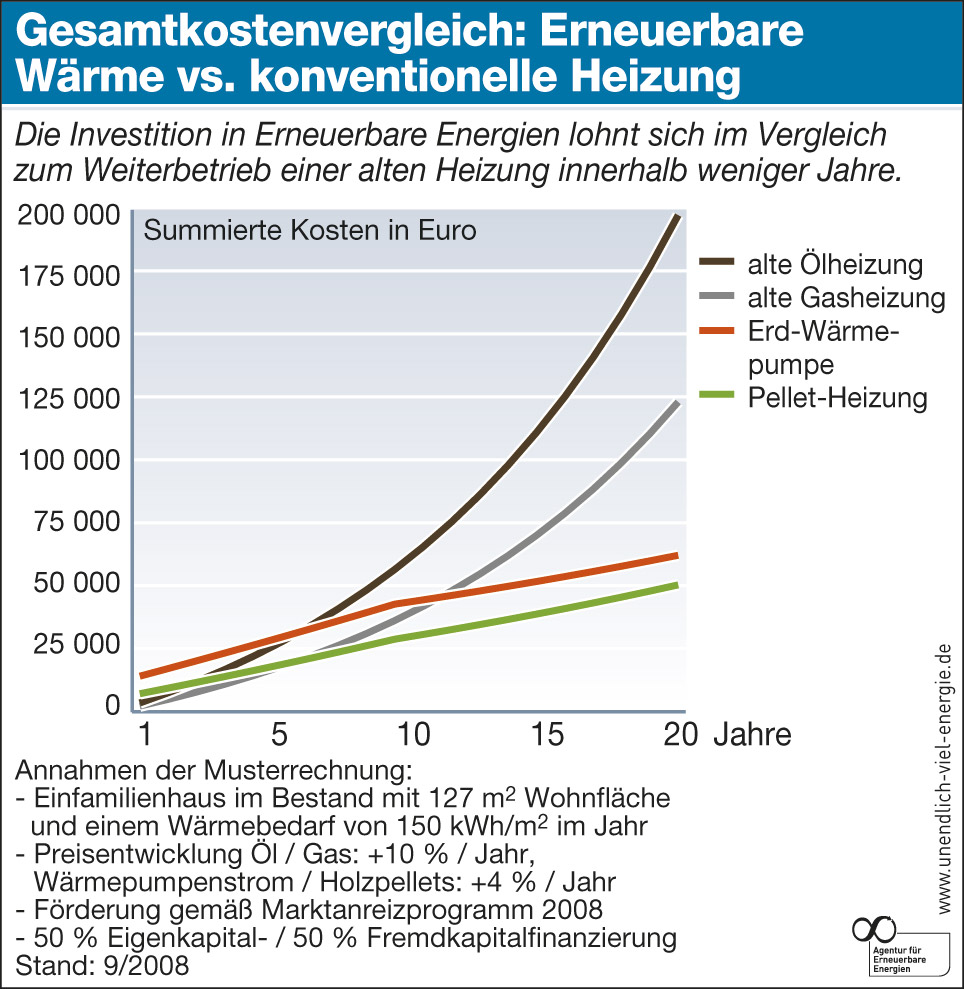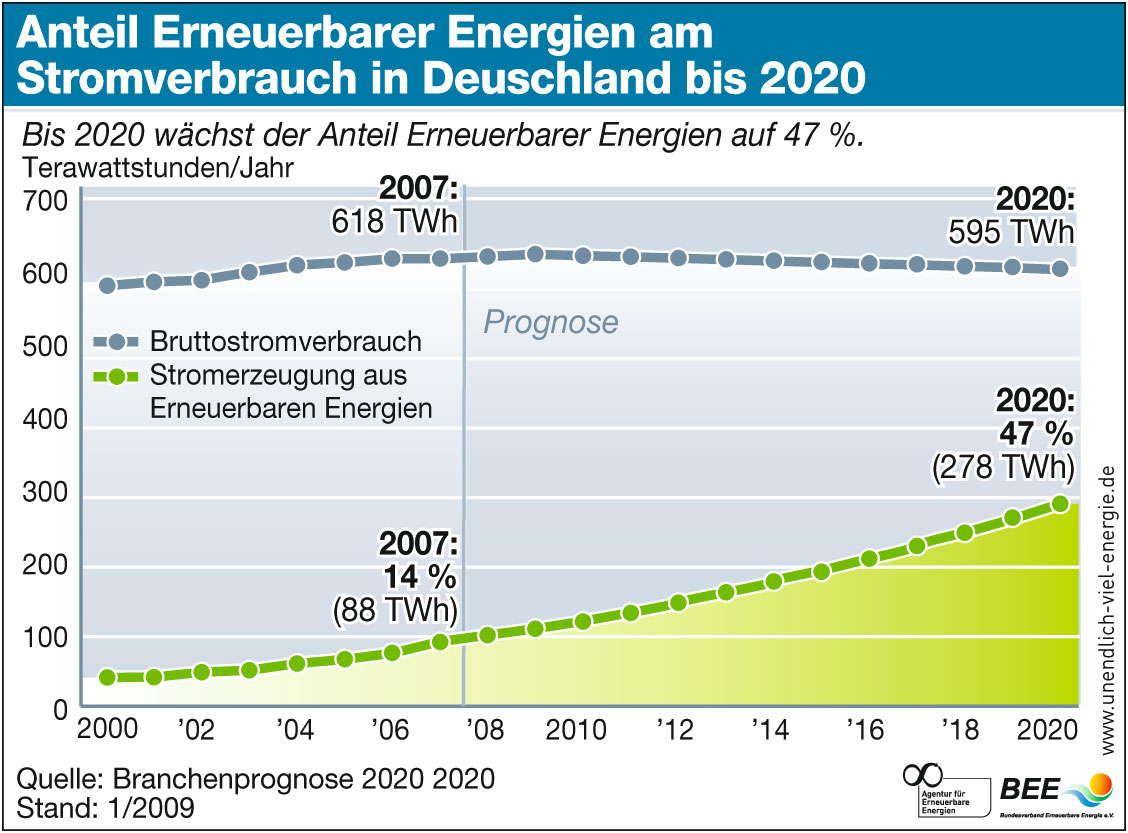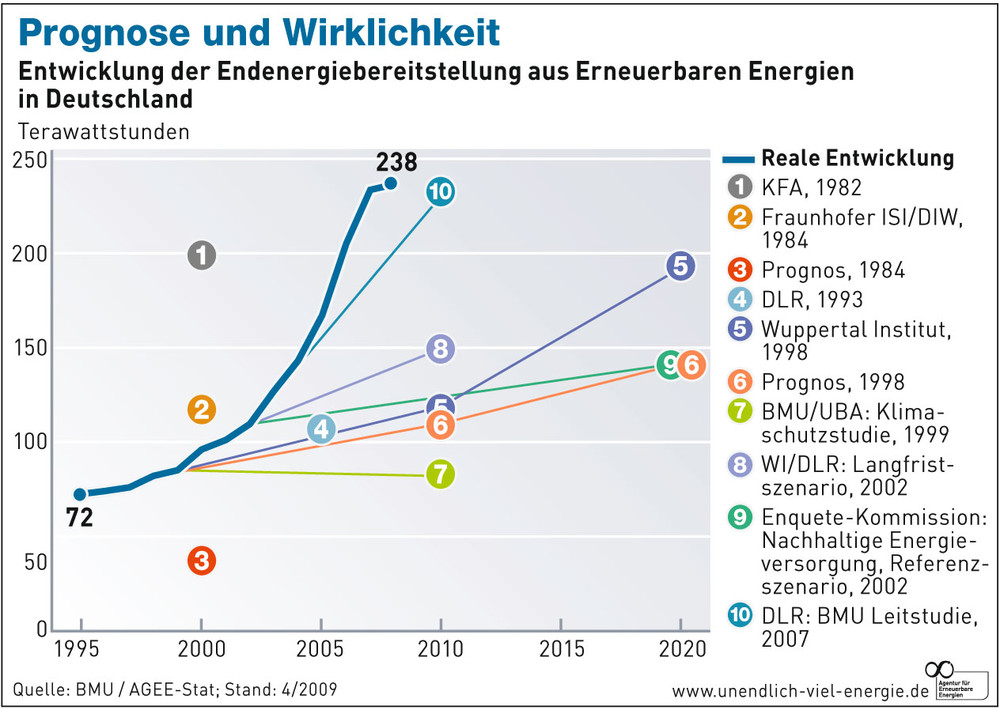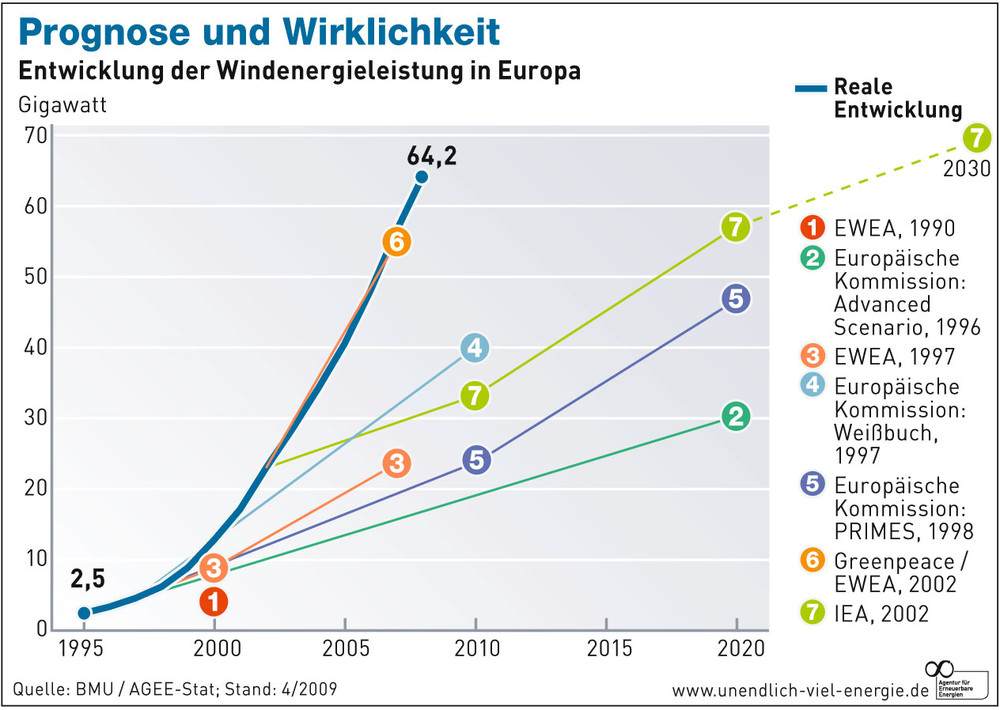1201
TGA wie Wärmespeicher , Lüftungstechnik ,... / Möglichkeiten einer Erdwärmetauscherverlegung
« am: 05. Juli 2009, 22:51:31 »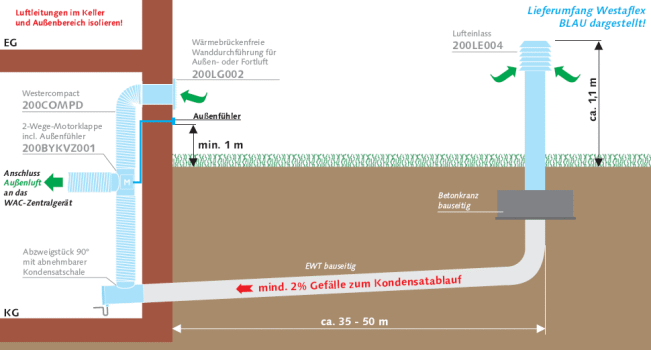
Hier handelt es sich um die bestmögliche Verlege-Situation: Hauseinführung im Keller. Vom Ansaugschacht wird mit dem Erdwärmetauscher-Rohr zum Haus hin (Kondensat läuft mit dem Luftstrom) ein 2%iges gefälle verlegt. Das T-Stück über dem Revisionsanschlußstück (Kondensatauslauf) ist nur nötig, wenn Sie einen Bypass betreiben möchten.
Der Bypass regelt den Volumenstrom so, dass das Verhältnis der Außenluft, die durch den EWT strömt und die, die direkt über die Wanddurchführung angesaugt wird, die optimale Außenzuluft-Temperatur für die Lüftungsanlage ergeben.
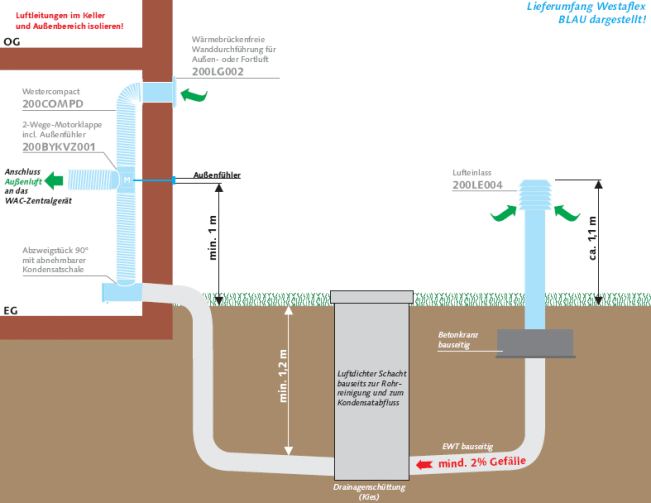
Hier wird gezeigt, wie ein EWT auch ohne Keller betrieben werden kann. Diese Möglichkeit habe ich (gezwungener Maßen) bei meinem Haus auch eingesetzt. Als Schacht dient KG300, welches oben und unten mit Enddeckeln verschlossen ist. Die Abgänge zum Haus hin und an das EWT-Rohr bestehen aus zwei T-Stücken und passenden Reduzierungen von DN300 auf DN200. Alle Verbindungen wurden mit Espansit6 verklebt. Auf dem Boden dieses Schachtes ist eine Pumpe installiert, die ab einem bestimmten Wasserstand das Kondensat nach draußen pumpt. Wer die Zeit hat, regelmäßig den Füllstand zu kontrollieren, kann auch auf die feste Installation einer Pumpe verzichten.
Vor allem im Sommer fällt in einem Erdwärmetauscher einiges an Kondensat aus. Dieses muß abgeführt werden. Damit keine Verbindung zum Kanal besteht, sollte auf jeden Fall ein doppelter Siphon verwendet werden. Falls der Siphon wegen mangelndem Kondensat austrocknen sollte, würde ansonsten die Luft aus dem Kanal in die angesaugte Außenluft gelangen.
Wenn kein Keller vorhanden ist, muß normalerweise ein Schacht gesetzt werden. Hier eine Prinzipzeichnung:
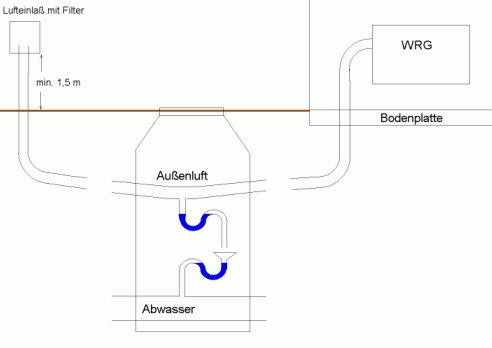
Fall kein direkter Anschluß an den Kanal möglich ist, sollte eine Kondensatpumpe verwendet werden.
Wenn ein Keller vorhanden ist, kann hier der Kondensatstutzen angebracht werden. Hier für ist folgendes T-Stück sehr gut geeignet:
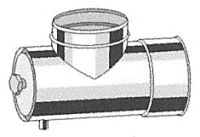
Rechts wird der EWT angeschlossen (direkt nach der Hauseinführung) und wird nach oben an die Lüftungsanlage weitergeleitet. Eine spätere Reinigungs-Spühlung des Rohres kann durch den abnehmbaren Revisionsdeckel sehr gut durchgeführt werden. Da dieses T-Stück aus Edelstahl gefertigt wird, ist es nahezu “unverwüstlich”.
Für das Hekatherm-EWT-Rohr wird direkt vom Hersteller ein extra Revisionschacht angeboten. Hierbei handelt es sich um ein sehr gutes Schachtsystem, welches ohne großen Aufwand dicht ist. Bei Betonringen kann dies evtl. zu einem langwierigen Kampf gegen die Setzung ausarten.
Der Schacht ist optimal abgestimmt auf das Hekatherm-Rohr, oben ist eine Muffe DN200 eingebracht, wo z.B. der Westaflex EWT-Lufteinlaß einfach aufgesteckt werden kann.
Jede Steckverbindung von EWT-Rohren im Erdreich sollte mit einem Korrosionsschutzband abgedichtet werden, damit keine Pilze bzw. Mikroorganismen, Wurzeln oder gar Wasser in die Verbindung eindringen können.
Wenn ein EWT in Häuser mit drückendem Wasser eingeführt wird, muß eine ordentliche Abdichtung her. Hierfür benötigt man zwei komponenten:
1. eine Dichte Mauerdurchführung
2. eine passende Ringraumdichtung
Bei Beton- und Gemauerten Kellern kann man sehr schön eine dieser Mauerdurchführungen (Futterrohre) einsetzen.
Diese Durchführungen können sowohl für das Hekatherm200, als auch für andere Wärmetauscher oder Rohre eingesetzt werden.
Als Rohrabdichtung (zwischen Mauerhülse und Rohr) empfehle ich die passende Link-Seal Ringraumdichtung. Diese gibt es auch für viele andere Rohrdurchmesser.
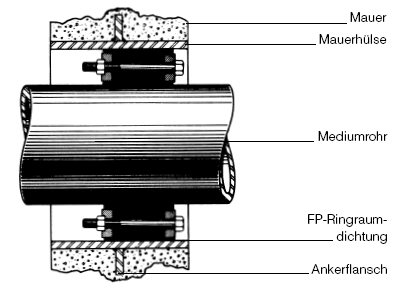
Kurze Beschreibung der Montage:
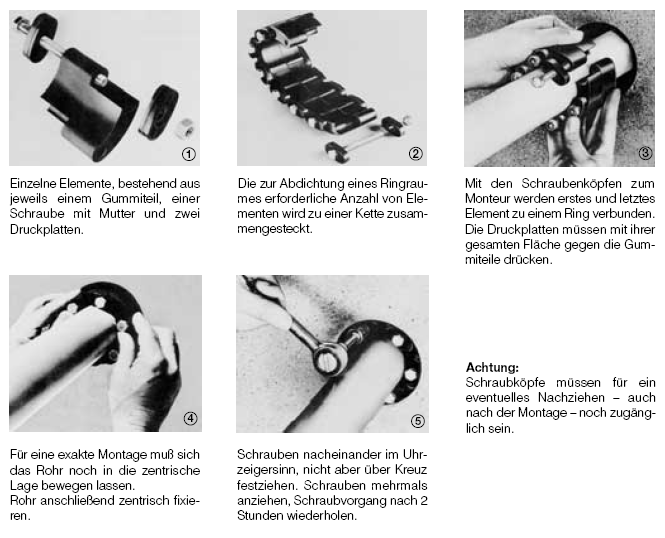
Die Link-Seal Ringraumdichtung hat eine Druckdichte von ca. 2 Bar!
Quelle: Westaflex